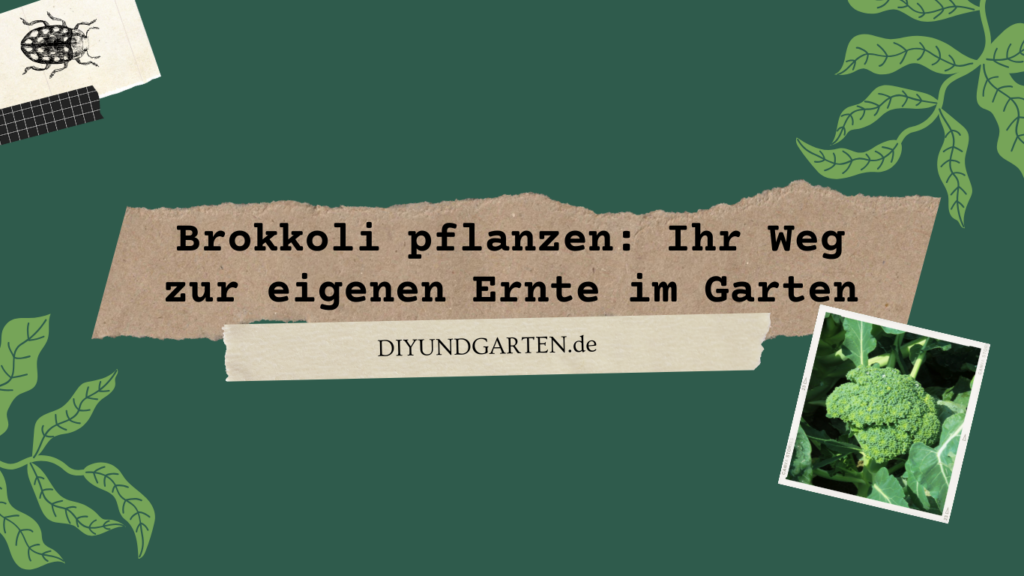Der Anbau von Rosenkohl, botanisch Brassica oleracea var. gemmifera, stellt für den ambitionierten Selbstversorger eine ebenso anspruchsvolle wie lohnende Herausforderung dar. Dieses Mitglied der Familie der Kreuzblütler (Brassicaceae) ist bekannt für seine langen Standzeiten im Beet und seine spezifischen Anforderungen an Standort, Boden und Pflege. Wer sich jedoch auf diese gärtnerische Expedition einlässt, wird im Spätherbst und Winter mit einer reichen Ernte an nährstoffreichen, schmackhaften Röschen belohnt – eine wertvolle Ergänzung für die saisonale Küche. Diese Mission erstreckt sich von der strategischen Planung und Aussaat im Frühjahr über eine monatelange Pflegephase bis hin zur finalen Ernte, oft erst nach den ersten prägenden Frösten. Ziel dieses Dokuments ist die Bereitstellung präziser Daten, bewährter Techniken und taktischer Hinweise, um die Kultivierung von Rosenkohl erfolgreich zu gestalten und eine ertragreiche Winterernte sicherzustellen. Das korrekte Vorgehen beim Rosenkohl anbauen ist der Schlüssel zum Erfolg.
Planung der Operation – Standortwahl und Bodenvorbereitung
Jede erfolgreiche Mission beginnt mit sorgfältiger Planung und der Wahl des richtigen Einsatzgebietes. Beim Rosenkohl Anbauen sind Standort und Bodenzustand fundamentale Faktoren, die über Gedeih oder Verderb entscheiden. Fehler in dieser frühen Phase lassen sich später nur schwer korrigieren.
Territoriumsanalyse: Der optimale Standort für Rosenkohl
Die Wahl des Standortes folgt klaren Kriterien. Rosenkohl benötigt für optimales Wachstum und die Ausbildung fester Röschen eine volle Sonnenexposition. Mindestens sechs Stunden direktes Sonnenlicht pro Tag sind als Minimum anzusetzen; mehr ist vorteilhaft. Dies gewährleistet die notwendige Energie für die Photosynthese und das kräftige Wachstum über die lange Vegetationsperiode.
Ein weiterer wichtiger Faktor ist der Schutz vor starkem Wind. Rosenkohlpflanzen können beachtliche Höhen erreichen (oft über einen Meter) und sind durch ihren relativ schlanken Haupttrieb und die schweren Röschen anfällig für Windbruch. Eine windgeschützte Lage, beispielsweise durch Hecken, Mauern oder andere Kulturen, minimiert dieses Risiko und sorgt für stabilere Pflanzen.
Die Bodenzusammensetzung ist ebenso kritisch. Ideal ist ein tiefgründiger, humusreicher und gut durchlässiger Lehmboden, der ausreichend Feuchtigkeit speichern kann, ohne zu Staunässe zu neigen. Rosenkohl bevorzugt einen neutralen bis leicht alkalischen pH-Wert im Bereich von 6,5 bis 7,5. Ein solcher pH-Wert fördert nicht nur die optimale Nährstoffaufnahme, sondern wirkt auch präventiv gegen die gefürchtete Kohlhernie.
Experten-Hinweis: “Die regelmäßige Überprüfung des pH-Wertes, idealerweise im Herbst vor der Pflanzung, ist beim Anbau von Kohlarten unerlässlich. Eine einfache Bodenanalyse aus dem Fachhandel gibt schnell Aufschluss und ermöglicht rechtzeitige Korrekturmaßnahmen.”
Zur Vermeidung von Risikozonen gehört zwingend die Einhaltung einer strengen Fruchtfolge. Da Rosenkohl zu den Kreuzblütlern (Brassicaceae) gehört, sollte er keinesfalls nach anderen Mitgliedern dieser Familie (wie Kopfkohl, Brokkoli, Blumenkohl, Rettich oder Senf) angebaut werden. Eine Anbaupause von mindestens drei, besser vier Jahren auf derselben Fläche ist entscheidend, um den Boden gesund zu halten und spezifische Krankheiten wie die Kohlhernie zu verhindern, deren Erreger (Plasmodiophora brassicae) jahrelang im Boden überdauern können. Wer erfolgreich Rosenkohl anbauen möchte, darf diesen Punkt nicht vernachlässigen.
Ressourcenmanagement: Bodenaufbereitung und Grunddüngung
Rosenkohl zählt zu den Starkzehrern. Dies bedeutet, er hat einen sehr hohen Bedarf an Nährstoffen, insbesondere an Stickstoff (N) für das Blatt- und Sprosswachstum, Phosphor (P) für die Wurzelbildung und Blüten-/Fruchtentwicklung (hier die Röschen) sowie Kalium (K) für die allgemeine Pflanzengesundheit, Frosthärte und den Wasserhaushalt. Eine unzureichende Nährstoffversorgung führt unweigerlich zu Kümmerwuchs und geringer Ernte.
Die Vorbereitungsmaßnahmen für das Beet beginnen idealerweise bereits im Herbst vor der Pflanzung oder spätestens im zeitigen Frühjahr. Ein tiefes Umgraben oder Lockern des Bodens ist empfehlenswert, um eine gute Durchwurzelbarkeit zu gewährleisten und eventuelle Bodenverdichtungen aufzubrechen. Gleichzeitig wird eine großzügige Menge an organischem Material eingearbeitet. Reifer Kompost (etwa 3 bis 5 Liter pro Quadratmeter) verbessert die Bodenstruktur, fördert das Bodenleben und liefert eine Basisversorgung mit Nährstoffen. Ergänzend kann ein organischer Langzeitdünger, wie Hornspäne oder ein spezieller Gemüsedünger, gemäß Packungsanleitung eingearbeitet werden.
Zur Bodenverbesserung kann bei Bedarf, basierend auf der Bodenanalyse, eine Kalkung erfolgen. Gartenkalk oder Algenkalk hebt den pH-Wert an und verbessert die Krümelstruktur von schweren Böden, was die Durchlüftung und Wasserführung optimiert. Calcium ist zudem ein wichtiger Pflanzennährstoff.
Haben Sie bereits Erfahrungen mit der Bodenanalyse und Kalkung für Starkzehrer gemacht? Teilen Sie Ihre Erkenntnisse gerne in den Kommentaren!
Einsatzbeginn – Aussaat und Pflanzung des Rosenkohls
Nach der sorgfältigen Vorbereitung des Terrains beginnt der eigentliche Einsatz: die Etablierung der Pflanzen im Beet. Timing und Methode sind hierbei entscheidend für einen erfolgreichen Start der langen Wachstumsphase.

Zeitfenster und Methode: Die Aussaat
Grundsätzlich gibt es zwei operative Vorgehensweisen für die Aussaat von Rosenkohl:
- Vorkultur im Innenraum: Diese Methode wird oft bevorzugt, um einen Wachstumsvorsprung zu erzielen und eine frühere Ernte zu ermöglichen. Der optimale Zeitpunkt für die Vorkultur liegt zwischen Februar und März. Die Samen werden etwa 1 cm tief in Aussaatschalen oder kleine Töpfe mit Anzuchterde gesät. Die ideale Keimtemperatur liegt bei 15-18°C. Nach der Keimung benötigen die Sämlinge einen hellen, aber nicht zu warmen Standort, um Geilwuchs (überlanges, schwaches Wachstum) zu vermeiden.
- Direktsaat ins Freiland: Alternativ können die Samen von April bis Mai direkt ins vorbereitete Beet gesät werden. Die Saattiefe beträgt hier etwa 1-2 cm. Diese Methode erspart das Pikieren und Umpflanzen, birgt jedoch das Risiko von Witterungseinflüssen und Schädlingsfraß an den jungen Keimlingen.
Wann sät man Rosenkohl aus? Die Antwort hängt also von der gewählten Methode ab – Februar/März für die Vorkultur, April/Mai für die Direktsaat.
Unabhängig von der Methode ist bei zu dichter Saat ein Pikieren notwendig. Sobald die Sämlinge neben den Keimblättern die ersten echten Blätter entwickelt haben, werden sie vorsichtig vereinzelt und in größere Töpfe oder, bei Direktsaat, auf den endgültigen Abstand ausgedünnt. Dies gibt jeder Pflanze genügend Raum zur Entwicklung.
| Methode | Zeitpunkt | Saattiefe | Temperatur | Vorteile | Nachteile |
| Vorkultur | Feb – März | ca. 1 cm | 15-18°C | Früherer Start, Kontrolle | Pikieren nötig, Abhärtung, Transplantationsstress |
| Direktsaat | Apr – Mai | 1-2 cm | Bodentemp. | Kein Pikieren/Umpflanzen | Witterungsabhängig, spätere Ernte, Schädlingsrisiko |
Etablierung im Feld: Das Auspflanzen der Jungpflanzen

Der Umzug der vorgezogenen Jungpflanzen ins Freiland oder das finale Ausdünnen der Direktsaat erfolgt, wenn keine Spätfröste mehr zu erwarten sind. Dies ist in den meisten Regionen Deutschlands ab Mitte Mai bis Mitte Juni, nach den sogenannten Eisheiligen, der Fall.
Wann pflanzt man Rosenkohl ins Freiland? Der Stichtag ist das Ende der Frostgefahr, typischerweise Mitte Mai.
Vorgezogene Pflanzen müssen vor dem Auspflanzen unbedingt abgehärtet werden. Das bedeutet, sie werden über einen Zeitraum von 7-10 Tagen schrittweise an die Außenbedingungen (Sonne, Wind, Temperaturschwankungen) gewöhnt. Beginnen Sie damit, die Pflanzen stundenweise an einen schattigen, geschützten Platz im Freien zu stellen und verlängern Sie die Dauer täglich, wobei direkte Mittagssonne anfangs vermieden wird.
Die Pflanzdistanz ist ein kritischer Faktor für den Erfolg beim Rosenkohl anbauen. Die Pflanzen benötigen ausreichend Platz für ihre Entwicklung und eine gute Luftzirkulation, die Pilzkrankheiten vorbeugt. Ein Abstand von mindestens 50×60 cm ist notwendig, besser sind 60×70 cm oder sogar 70×70 cm. Dieser großzügige Abstand mag anfangs übertrieben wirken, ist aber für die stattlichen Pflanzen und die Ausbildung großer, gesunder Röschen essenziell.
Wie viel Abstand braucht Rosenkohl? Planen Sie mindestens 60×60 cm pro Pflanze ein.
Beim Einpflanzen werden die Jungpflanzen tiefer gesetzt, als sie im Anzuchttopf standen – idealerweise bis zu den unteren Blättern (Keimblätter, falls noch vorhanden). Dies fördert die Bildung zusätzlicher Wurzeln am Stängelgrund (Adventivwurzeln) und verleiht der hochwachsenden Pflanze deutlich mehr Standfestigkeit. Nach dem Einsetzen wird die Erde gut angedrückt und die Pflanze kräftig angegossen (eingeschlämmt), um einen guten Bodenschluss sicherzustellen.
Langzeitmission – Pflege und Versorgung während des Wachstums
Die Phase nach der Pflanzung ist eine Langzeitmission, die konstante Aufmerksamkeit und gezielte Versorgungsmaßnahmen erfordert. Nur durch kontinuierliche Pflege können die Pflanzen ihr volles Potenzial entfalten und eine reiche Ernte liefern.
Hydration sichern: Regelmäßige Wasserversorgung
Rosenkohl hat einen hohen Wasserbedarf, besonders während trockener Perioden und in der Hauptwachstumsphase, wenn die Röschenbildung beginnt (ab Spätsommer). Eine gleichmäßige Bodenfeuchtigkeit ist entscheidend. Trockenstress kann zu Wachstumsstockungen und einer verminderten Qualität der Röschen führen. Andererseits muss Staunässe unbedingt vermieden werden, da sie Wurzelfäule begünstigt und die Gefahr von Pilzkrankheiten erhöht.
Die Bewässerungstechnik sollte darauf abzielen, die Blätter möglichst trocken zu halten. Gießen Sie daher direkt auf den Boden im Wurzelbereich, idealerweise am Morgen, damit die Pflanzenoberfläche schnell abtrocknen kann. In Trockenperioden kann es notwendig sein, durchdringend zu wässern (ca. 10-15 Liter pro Quadratmeter), statt nur oberflächlich zu sprengen.
Nährstoffnachschub: Düngung für Starkzehrer
Wie bereits etabliert, ist Rosenkohl ein Starkzehrer. Die bei der Bodenvorbereitung eingebrachte Grunddüngung reicht für die lange Vegetationsperiode meist nicht aus. Eine gezielte Nachdüngung ist erforderlich.
Die Strategie sieht in der Regel zwei Gaben vor:
- Die erste Nachdüngung erfolgt etwa 4 bis 6 Wochen nach dem Auspflanzen, wenn die Pflanzen gut angewachsen sind und das Hauptwachstum beginnt. Hier eignet sich ein stickstoffbetonter Dünger, um das Blatt- und Stängelwachstum zu fördern. Bewährt haben sich organische Optionen wie verdünnte Brennnesseljauche, Hornspäne oder ein ausgewogener organischer Gemüsedünger.
- Die zweite Düngung wird im Spätsommer (ca. August) empfohlen, wenn die Röschenbildung einsetzt. Hier kann ein Dünger mit etwas höherem Kaliumanteil vorteilhaft sein, um die Festigkeit und Winterhärte der Röschen zu unterstützen.
Muss man Rosenkohl düngen? Ja, als Starkzehrer ist eine gezielte Düngung für eine gute Ernte unerlässlich.
Vorsicht: Vermeiden Sie eine übermäßige Stickstoffgabe, insbesondere spät in der Saison (ab September). Zu viel Stickstoff fördert zwar üppiges Blattwachstum, dies geht jedoch oft zulasten der Röschenbildung – sie bleiben klein oder bilden sich nur locker aus.
Praxis-Tipp: “Beobachten Sie die Blattfarbe Ihrer Rosenkohlpflanzen. Eine gesunde Pflanze zeigt ein sattes Dunkelgrün. Hellgrüne oder gelbliche Blätter können auf Stickstoffmangel hindeuten und ein Signal für eine moderate Nachdüngung sein.”
Umfeldkontrolle: Hacken, Mulchen und Stützen

Die Kontrolle des direkten Umfeldes der Pflanzen ist ein wichtiger Teil der Pflegestrategie.
- Unkrautbekämpfung: Regelmäßiges, flaches Hacken zwischen den Pflanzen hält Unkrautkonkurrenz um Wasser, Licht und Nährstoffe in Schach. Gleichzeitig wird die oberste Bodenschicht gelockert, was die Belüftung verbessert und die Wasserverdunstung reduziert (Prinzip: “Einmal hacken spart dreimal gießen”).
- Mulchen: Das Aufbringen einer Mulchschicht (z.B. angetrockneter Rasenschnitt, Stroh, Holzhackschnitzel) nach dem Angießen und Lockern des Bodens ist sehr vorteilhaft. Mulch unterdrückt Unkrautwachstum, hält die Bodenfeuchtigkeit konstant, schützt den Boden vor Erosion und Verschlämmung bei Starkregen und fördert das Bodenleben.
- Stabilisierung: Hochwachsende Sorten, besonders an windexponierten Standorten, benötigen oft zusätzliche Stabilisierung. Das Befestigen der Pflanzen an einem stabilen Stab (z.B. Bambus oder Holzpfahl) verhindert das Umknicken. Zusätzlich kann durch Anhäufeln von Erde am Stängelgrund die Standfestigkeit deutlich verbessert werden. Dies regt zudem die Bildung weiterer Adventivwurzeln an.
Ertragsoptimierung: Das Köpfen der Pflanzen (Optional)
Eine spezielle Kulturmaßnahme zur Ertragsoptimierung ist das sogenannte Köpfen. Hierbei wird ab September oder Oktober die oberste Triebspitze (Terminalknospe) der Pflanze herausgebrochen oder abgeschnitten.
Der Effekt dieser Maßnahme ist, dass die Pflanze ihre Wachstumsenergie nicht mehr in die Höhe, sondern verstärkt in die Entwicklung der seitlich in den Blattachseln sitzenden Röschen lenkt. Dies führt oft zu größeren, festeren und gleichmäßiger reifenden Röschen. Diese Methode ist jedoch nicht bei allen Sorten notwendig oder empfohlen – manche moderne Züchtungen sind auf eine gute Röschenentwicklung auch ohne Köpfen selektiert. Aus eigener Erfahrung können wir berichten, dass bei älteren, traditionellen Sorten das Köpfen oft einen sichtbaren Vorteil bringt.
Gefahrenabwehr – Management von Krankheiten und Schädlingen
Auch die robusteste Expedition ist nicht vor Gefahren sicher. Beim Rosenkohl anbauen stellen spezifische Krankheiten und Schädlinge potenzielle Bedrohungen dar, die frühzeitig erkannt und gemanagt werden müssen.

Biologische Bedrohungen: Kohlhernie und Falscher Mehltau
- Kohlhernie: Dies ist eine der gravierendsten Krankheiten bei Kohlarten. Verursacht durch den Schleimpilz Plasmodiophora brassicae, führt sie zu kropfartigen Wucherungen an den Wurzeln. Die Nährstoff- und Wasseraufnahme wird massiv gestört, die Pflanzen welken bei Sonnenschein, bleiben im Wachstum zurück und bilden kaum oder keine Röschen.
- Prävention: Die Bekämpfung ist schwierig, daher ist Prävention entscheidend: Strikte Einhaltung der Anbaupause (mind. 4 Jahre), Sicherstellung eines optimalen pH-Wertes (über 7,0), Verwendung resistenter Sorten (falls verfügbar und geeignet) und strenge Hygiene (keine Verschleppung von Erde aus befallenen Beeten).
- Maßnahmen bei Befall: Befallene Pflanzen müssen umgehend und vollständig (mit Wurzelballen) entfernt und über den Hausmüll entsorgt werden – niemals auf den Kompost geben, da die Dauersporen extrem langlebig sind!
- Falscher Mehltau: Diese Pilzkrankheit zeigt sich durch einen weißlichen bis gräulichen Pilzrasen auf der Blattunterseite und gelblichen Flecken auf der Blattoberseite. Bei starkem Befall können Blätter absterben.
- Prävention: Ausreichender Pflanzabstand für gute Luftzirkulation, bedarfsgerechte Bewässerung (Blätter trocken halten), Vermeidung von stickstoffüberdüngter Weichblättrigkeit.
Invasoren im Sektor: Kohlweißling, Kohlfliege und Blattläuse
Verschiedene Schädlinge können die Rosenkohl-Mission gefährden:
- Kohlweißling (Großer und Kleiner): Nicht die Schmetterlinge selbst, sondern ihre Raupen verursachen den Schaden. Sie fressen an den Blättern, oft bis auf die Blattrippen (Skelettierfraß), und können bei starkem Befall auch die Röschen schädigen oder durch Kot verunreinigen.
- Management: Regelmäßige Kontrolle und manuelles Absammeln der gut sichtbaren Raupen (und Eigelege auf der Blattunterseite). Der Einsatz von Kulturschutznetzen direkt nach der Pflanzung ist eine sehr effektive Methode, um die Eiablage durch die Falter zu verhindern. Biologische Präparate auf Basis von Bacillus thuringiensis (Bt) wirken spezifisch gegen Schmetterlingsraupen.
- Kohlfliege: Die Maden der kleinen Kohlfliege fressen an den Wurzeln junger Kohlpflanzen, was zu Welkeerscheinungen und im schlimmsten Fall zum Absterben führt.
- Management: Kulturschutznetze verhindern ebenfalls die Eiablage. Sogenannte Kohlkragen (Scheiben aus Pappe oder Kunststoff, die um den Stängelgrund gelegt werden) verhindern, dass die Maden nach dem Schlupf zu den Wurzeln gelangen.
- Blattläuse: Verschiedene Blattlausarten können Rosenkohl befallen, oft an den Triebspitzen und jungen Blättern. Sie saugen Pflanzensaft, schwächen die Pflanze und können Viren übertragen. Zudem scheiden sie Honigtau aus, der Rußtaupilze anlockt.
- Management: Förderung von Nützlingen (Marienkäfer, Florfliegen, Schlupfwespen) durch naturnahe Gartengestaltung. Bei leichtem Befall können die Läuse mit einem scharfen Wasserstrahl abgespritzt oder mit einer Schmierseifenlösung behandelt werden. Nur bei sehr starkem Befall sollten zugelassene, nützlingsschonende Insektizide in Betracht gezogen werden.
Was sind Ihre bewährten Methoden zur Abwehr dieser Schädlinge beim Rosenkohl anbauen?
Zielerreichung – Die Ernte des Rosenkohls
Nach Monaten der Planung, Pflanzung und Pflege naht der Höhepunkt der Mission: die Ernte der wohlverdienten Ausbeute. Der richtige Zeitpunkt und die passende Technik sind entscheidend für Qualität und Geschmack.

Signal zur Bergung: Erntereife und optimaler Zeitpunkt
Die Indikatoren für die Erntereife sind relativ eindeutig: Die Röschen in den Blattachseln sollten fest geschlossen sein und die gewünschte Größe erreicht haben, typischerweise einen Durchmesser von 2 bis 4 cm. Zu lange gewartete Röschen können sich lockern und an Qualität verlieren.
Die Ernteperiode beginnt je nach Sorte, Pflanztermin und Witterung im Oktober oder November und kann sich bei frostharten Sorten bis in den Februar oder sogar März des Folgejahres erstrecken. Rosenkohl ist somit ein klassisches Wintergemüse.
Wann ist Rosenkohl erntereif? Wenn die unteren Röschen fest und 2-4 cm groß sind, beginnt die Erntezeit, meist ab Oktober/November.
Der Kältefaktor: Ernte nach dem Frost

Ein weit verbreiteter Ratschlag ist, Rosenkohl erst nach dem ersten Frost zu ernten. Dies hat einen biochemischen Hintergrund: Bei leichten Frösten (Temperaturen um -3°C bis -5°C) wandelt die Pflanze einen Teil der gespeicherten Stärke in Zucker um. Dies dient als eine Art Frostschutzmittel für die Zellen.
Der Effekt für den Geschmack ist positiv: Die Röschen werden dadurch milder, süßer und insgesamt aromatischer. Der oft als streng empfundene Kohlgeschmack wird abgemildert.
Braucht Rosenkohl Frost zum Ernten? Nicht zwingend, aber leichter Frost verbessert den Geschmack deutlich. Erfahrene Gärtner warten daher oft bewusst die ersten kälteren Nächte ab.
Die Erntestrategie ist ebenfalls wichtig: Rosenkohl wird von unten nach oben geerntet. Die untersten, reifen Röschen werden zuerst entnommen. Dies geschieht am besten durch vorsichtiges Abbrechen oder Abschneiden dicht am Hauptstrunk. Gleichzeitig können die darunterliegenden, oft schon vergilbenden Blätter entfernt werden. Dies schafft Platz, verbessert die Luftzirkulation und lenkt die Kraft der Pflanze in die oberen, noch wachsenden Röschen. So kann über mehrere Wochen oder Monate hinweg immer wieder frisch geerntet werden.
Sicherung der Ausbeute: Lagerung und Verwertung
Frisch geernteter Rosenkohl hält sich im Gemüsefach des Kühlschranks nur wenige Tage. Für eine längere Haltbarkeit ist die Frostung die Methode der Wahl. Dazu werden die Röschen geputzt, gewaschen und für etwa 3-4 Minuten in kochendem Wasser blanchiert, anschließend sofort in Eiswasser abgeschreckt, gut abgetropft und dann eingefroren. So behalten sie Farbe, Textur und einen Großteil ihrer Vitamine.
Die Verwendung in der Küche ist vielseitig. Ob klassisch gekocht oder gedünstet als Beilage, in Butter geschwenkt, gebraten (z.B. mit Speck und Zwiebeln), im Ofen geröstet, als Bestandteil von Eintöpfen und Suppen oder überbacken in einem Auflauf – Rosenkohl bietet zahlreiche Möglichkeiten für die nährstoffreiche Winterküche.
Fazit (Missions-Debriefing)
Die Expedition “Rosenkohl anbauen” ist erfolgreich abgeschlossen, wenn die Prinzipien konsequent verfolgt wurden. Die kritischen Erfolgsfaktoren lassen sich klar benennen: eine sorgfältige Standortwahl mit optimalen Bodenbedingungen, die Einhaltung der Fruchtfolge, eine bedarfsgerechte Wasser- und Nährstoffversorgung unter Berücksichtigung des Starkzehrer-Status, ein wachsames Management von Krankheiten und Schädlingen sowie der korrekte Erntezeitpunkt, idealerweise unter Nutzung des positiven Frost-Effekts.
Das Ergebnis rechtfertigt den Aufwand: Der erfolgreiche Anbau von Rosenkohl liefert über einen langen Zeitraum hochwertiges, vitaminreiches (besonders Vitamin C und K) und schmackhaftes Wintergemüse direkt aus dem eigenen Territorium.
Die abschließende Bewertung ist eindeutig: Eine methodische Vorgehensweise, Geduld und die Beachtung der spezifischen Anforderungen dieser anspruchsvollen, aber dankbaren Kulturpflanze führen zuverlässig zur erfolgreichen Ernte und bereichern den winterlichen Speiseplan auf gesunde Weise. Die Mission “Rosenkohl Anbauen” ist eine lohnende Herausforderung für jeden erfahrenen Gärtner.